|
Nahost: »Ohne Wiedergutmachung werden die Gräuel weitergehen«
Rachel Beitarie von der israelischen NGO Zochrot kritisiert den Förderstopp des Auswärtigen Amtes
Interview: Susanne Hentschel - 12.01.2025
Die Palästinenserin Ebthaj Dawla hat die Schlüssel zu ihrem Haus, das sie während der Nakba verlassen wurde, bis heute aufbewahrt. Die Erinnerung an die Vertreibung der Palästinenser durch jüdische Truppen sind ein Hindernis bei der Aussöhnung in der Region.
Die deutsche Finanzierung ihres Projekts Zochrot wurde gestrichen. Hat Sie das überrascht?
Nicht wirklich. Jetzt gibt es viel Empörung und auch ein großes Medieninteresse, das schätze ich. Was mich aber irritiert, ist, dass die palästinensischen Organisationen, denen schon vor längerer Zeit das Geld gestrichen wurde, kaum Beachtung finden. Hier zeigt sich die Ungleichbehandlung in der öffentlichen Debatte. Auch Al-Haq, einer palästinensischen Menschenrechtsorganisation, wurden die Mittel gestrichen – und das, obwohl alle Vorwürfe der israelischen Regierung gegen Al-Haq von Deutschland selbst und der EU zurückgewiesen wurden. Dieser Prozess läuft also schon lange. Überrascht war ich also nicht.
Deutschland rühmt sich selbst oft als Erinnerungsweltmeister, dreht nun aber den Geldhahn für ein Projekt zu, das genau der Erinnerung dient. Wie blicken Sie auf diese Gleichzeitigkeit?
Damit wird die Wiedergutmachung von der Erinnerung getrennt. Es kann aber kein Erinnern ohne Konsequenzen, ohne Aufarbeitung und Entschädigung geben. Ich weiß, dass viele Deutsche sehr stolz auf ihre Gedenkprojekte sind, und sie sind in der Tat sehr beeindruckend. Aber sie sind entstanden, nachdem das Regime, das die Verbrechen begangen hat, beseitigt wurde, nachdem wesentliche Schritte in Richtung Entschädigung, juristische Aufarbeitung und Veränderungen im Bildungssystem getan wurden. Lasst uns also darüber sprechen, wie Wiedergutmachung aussehen sollte. Wir von Zochrot sagen, die Wiedergutmachung heißt, dass alle Vertriebenen und Geflohenen zurückkehren können – aber darüber lässt sich streiten. Die Streichung der Mittel verhindert genau diese Diskussion.
Wie wurde der Förderstopp vom Auswärtigen Amt begründet?
Uns gegenüber gar nicht. Wir haben die Nachricht über unsere Partnerorganisation Kurve Wustrow erhalten. Eine offizielle Begründung gab es nicht. Dass das Auswärtige Amt die Finanzierung überdenkt, wussten wir allerdings schon seit Anfang letzten Jahres.
Als Zochrot arbeiten Sie zur Nakba, der systematischen Vertreibung der Palästinenser*innen im Zuge der Staatsgründung 1948, und zum Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge. Warum ist das Erinnern solch ein heikles Thema?
Man hat uns immer wieder gesagt: Gedenken ist schön und gut, aber nur so lange es nichts Grundlegendes verändert. Deshalb werden wir gerade für unseren Einsatz für das mehr >>> 
KURVE Wustrow, 08. Januar 2025 -
Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen vor einer herausfordernden Situation: Zwei unserer langjährigen israelischen Partnerorganisationen, „New Profile“ und „Zochrot“, wurde aus nicht haltbaren Gründen die außenpolitische Unbedenklichkeit durch die Bundesregierung und damit unsere komplette Projektförderung entzogen.
Diese Entscheidung stellt ihre wertvolle Arbeit für Frieden und Gerechtigkeit in Palästina/Israel in Frage und gefährdet die Unterstützung, die so dringend benötigt wird.
Lies mehr über die Hintergründe in unserer Pressemitteilung vom Montag.
Schau Dir den ausführlichen, englischsprachigen TV-Bericht der Deutschen Welle mit Stimmen unserer Partner vom Montag an oder lies den deutschsprachigen Artikel der Deutschen Welle vom Dienstag.
Wir brauchen Deine Unterstützung!
Unterzeichne und verbreite unsere Petition
an den Petitionsausschuss des Bundestages, um den Förderstopp für israelische und palästinensische Nichtregierungsorganisationen zurückzunehmen.
Unterstütze unsere beiden israelischen Partnerorganisationen mit einer Spende, um ihre wichtige Arbeit fortzusetzen.
Solidarische Grüße, John Preuss und Jochen Neumann

Um das Video zu sehen, auf das Bild klicken
6. Januar 2025 - Regierungspressekonferenz | BPK
Eine unvollständige Sammlung der bisherigen Pressestimmen
"Deutschland streicht Gelder für israelische NGOs", DW, 07.01.2025
"Förderstopp für zwei israelische NGOs", TAZ, 06.01.2025
"Bundesregierung schwächt gewaltfreie Akteure", ND, 06.01.2025
"Why is Germany defunding NGOs critical of the Israeli government?", DW News, 06.01.2025
"Germany defunds 2 Israeli human rights groups", DW, 05.01.2025
"Germany freezes funding of aid organizations, cutting off Israeli human rights groups", Haaretz, 06.01.2025
"Germany quietly cuts funding to two Israeli human rights organizations", The Jerusalem Post, 07.01.2025
"Bundespressekonferenz", Jung&Naiv, 06.01.2025 (ab 41:01 min) |
|

Dokumentation im "Das Palästina Portal" - Sonderseiten
Menschenrechtsorganisationen
die Israels Verbrechen dokumentieren
Israels Bemühungen sie zu vernichten
mehr >>> |
Unterstützt das Weiterbestehen des
„Das Palästina Portal“

In einer Medienlandschaft, in der kritische und wahrheitsgetreue Berichterstattung über Palästina immer noch eine Seltenheit ist, bleibt "Das Palästina Portal" standhaft - kompromisslos unabhängig, bewegungsgeführt und unbeirrbar in seinem Engagement.
Das Leiden der Palästinenserinnen und Palästinenser wird dokumentiert, die Heuchelei des Zionismus aufgedeckt, eine konditionierte Berichterstattung hinterfragt und die Unterwürfigkeit einer Politik entlarvt, die von Werten spricht, aber ihre eigenen Interessen über alles stellt.
Jeden Tag widersetzt sich "Das Palästina Portal" dem Schweigen und versucht, die Stimmen zu stärken, die für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen.
Kostenlos ist leider nicht kostenfrei.
Für dieses politisch unabhängige Engagement sind wir auf Unterstützung und Solidarität angewiesen. Wir freuen uns über jeden einmaligen oder auch regelmäßigen Beitrag. Sponsorenbeitrag
Wenn Sie dieses Portal nützlich und notwendig finden, wäre es sehr hilfreich, wenn Sie sich als einer der wenigen entscheiden und diese Arbeit unterstützen. So können wir weiterhin über die Ereignisse in Palästina berichten.
Mehr >>>
|
|

Weiter >>> |
|

Archiv - Demonstration zur Unterstützung Israels in London
Großbritannien warnt Chabad-Gruppe wegen Spendensammlung für israelischen Soldaten
Die Charity Commission gab bekannt, dass die Chabad Lubavitch Centers Geld für einen Soldaten gesammelt haben und fügte hinzu: „Es ist weder legal noch akzeptabel, Geld für einen Soldaten in einer ausländischen Armee zu sammeln“.
Liza Rozovsky - 12. Januar 2025 - Übersetzt mit DeepL
Die britische Regierung hat eine offizielle Warnung an die Wohltätigkeitsorganisation Chabad herausgegeben, nachdem eine lokale Zweigstelle Spenden für die israelische Armee gesammelt hatte.
In einer Erklärung der Wohltätigkeitskommission des Landes hieß es, die Chabad-Lubawitsch-Zentren in Nordost-London und Essex hätten begonnen, Spenden für einen Soldaten zu sammeln, der im Norden Israels diene, und dabei insgesamt £2.280 ($2.780) gesammelt.
Helen Earner, die für die Überwachung von Wohltätigkeitsorganisationen zuständige Aufsichtsbehörde, erklärte: „Es ist weder legal noch akzeptabel, dass eine Wohltätigkeitsorganisation Spenden für einen Soldaten in einer ausländischen Armee sammelt“. Nachdem die Kommission 180 Beschwerden über die Spendenkampagne erhalten und im Dezember 2023 eine Untersuchung der Angelegenheit eingeleitet hatte, wurde die Spendenseite im Januar 2024 geschlossen.
Die Regierungskommission stellte fest, dass „die Spendenkampagne nicht im Einklang mit den Zielen der Wohltätigkeitsorganisation stand - und nicht gemeinnützig sein konnte - und dass die Treuhänder es versäumt hatten, im besten Interesse der Wohltätigkeitsorganisation und ihres Rufs zu handeln. Dies stellte ein Fehlverhalten und/oder Missmanagement bei der Verwaltung der Wohltätigkeitsorganisation sowie einen Vertrauensbruch dar.“
Die Wohltätigkeitsorganisation hat sich die Förderung des orthodoxen Judentums und der orthodoxen jüdischen Bildung sowie die Linderung von Armut und Krankheit zum Ziel gesetzt, so die Aufsichtsbehörde.
Die Treuhänder des Chabad-Zentrums sagten, sie akzeptierten die Ergebnisse der Charity Commission, obwohl die offizielle Warnung „bedauerlich“ sei, berichtete der Jewish Chronicle. Die Treuhänder sagten, dass der Angriff vom 7. Oktober, die anhaltende Notlage der Geiseln und der andauernde Konflikt weiterhin eine „Quelle tiefer Traumata“ für die Gemeindemitglieder seien.
Gleichzeitig sind in Großbritannien Wohltätigkeitsorganisationen aktiv, um der Ukraine zu helfen - einschließlich ukrainischer Soldaten. So wurden laut der Website der Charity Commission keine Beschwerden gegen die Organisation „Hospitallers Ukraine Aid“ eingereicht, die offen erklärt, dass sie unter anderem Sanitäter unterstützt, die ukrainischen Soldaten an der Front helfen.
Im September kündigte der britische Außenminister David Lammy an, dass Großbritannien beschlossen habe, mehrere Waffenlieferungen an Israel auszusetzen, da der Krieg in Gaza andauere und man besorgt sei, dass es zu zahlreichen zivilen Opfern kommen werde. Lammy sagte, es bestehe ein „eindeutiges Risiko“, dass bestimmte Güter dazu verwendet werden könnten, „schwere Verletzungen des humanitären Völkerrechts zu begehen oder zu erleichtern“.
Er informierte das Parlament, dass die Entscheidung etwa 30 der 350 Ausfuhrgenehmigungen für Ausrüstung betrifft, die „für den Einsatz im aktuellen Konflikt in Gaza bestimmt ist“, darunter Teile für Militärflugzeuge und Drohnen sowie Gegenstände, die für Bodenangriffe verwendet werden. Er betonte, dass dies „keine Feststellung von Schuld oder Unschuld“ hinsichtlich der Frage sei, ob Israel gegen internationales Recht verstoßen habe, und stellte klar, dass es sich nicht um ein Waffenembargo handele.
Lammy sagte, dass Systeme im Zusammenhang mit dem F-35-Flugzeug, das Israel einen erheblichen militärischen Vorteil gegenüber den Staaten der Region verschafft, nicht betroffen seien. Andere Systeme im Zusammenhang mit Kampfflugzeugen, Hubschraubern und Bodenoperationen in Gaza seien jedoch von der Entscheidung betroffen. Quelle |
|

„Der Regen wird nicht ewig anhalten, mein Schatz": Eine lange Winternacht in einem Zelt in Gaza
In Gaza ist das Überleben ein täglicher Akt des Trotzes. In einem vom Regen durchnässten Zelt Momente des Lachens und der Wärme zu finden, grenzt an ein Wunder.
Imad Mahmoud 12. Januar 2025 - Übersetzt mit DeepL
Ein palästinensisches Kind späht aus dem Zelt seiner Familie in einem Lager für Vertriebene in der Stadt Deir al-Balah im mittleren Gazastreifen. Vor dem Zelt sammeln sich Regenwasserpfützen, die den Lehmboden in kalten Schlamm verwandeln.
Ein palästinensisches Kind späht aus dem Zelt seiner Familie in einem Lager für Vertriebene in der Stadt Deir al-Balah im mittleren Gazastreifen. Regenwasser sammelt sich außerhalb des Zeltes und verwandelt den Boden aus Erde in kalten Schlamm. Etwa 1,9 Millionen Palästinenser wurden durch den Völkermord Israels in Gaza vertrieben. Mit dem Wintereinbruch führen Regenfälle zu Überschwemmungen und stellen eine Katastrophe für die Menschen dar, die auf der Straße schlafen.
Meine 27-jährige Schwester Hanan befindet sich in einem endlosen Albtraum. Sie lebte mit ihrem Ehemann Fadi und ihren drei Kindern – Ibrahim (9), Nada (6) und Adnan (4) – in Al-Zawayda im mittleren Gazastreifen. Ihr Zuhause wurde durch israelische Bombenangriffe zerstört, und jetzt dient ein Zelt als einzige Unterkunft für sie und ihre Kinder – ein fragiler Raum, der sie kaum vor der Kälte des Winters oder dem unerbittlichen Regen schützt und das Gewicht ihrer Vergangenheit und die Hoffnung auf eine Zukunft trägt, die sich immer unerreichbarer anfühlt.
Laut „Medical Aid for Palestinians“ haben 1,9 Millionen Palästinenser – 90 % der Bevölkerung des Gazastreifens – im Krieg ihr Zuhause verloren. Hunderttausende Menschen leben jetzt in Zelten, aber das Leben in einem Zelt ist alles andere als ein Leben. Regen sickert durch jede Seite und zwingt Familien, das tropfende Wasser in alten Töpfen aufzufangen. Kinder schlafen auf dem kalten Boden. Die bittere Kälte hat in diesem Winter im Gazastreifen mindestens acht Babys getötet.
In einer kalten, regnerischen Nacht besuchte ich sie. Ich saß still in einer Ecke ihres Zeltes und beobachtete, wie Hanan ihre Kinder um sich scharte, um sie vor der beißenden Kälte zu schützen. Das Geräusch des Regens, der auf das abgenutzte Zeltdach prasselte, war ohrenbetäubend und übertönte fast unsere Stimmen. Ibrahim, der Älteste, versuchte, um seiner Geschwister willen tapfer zu wirken, aber in seiner Stimme klang Sorge durch, als er seine Mutter fragte:
„Mama, wird der Regen die ganze Nacht anhalten?“
Hanan lächelte sanft und versuchte, ihn zu trösten, während sie all den Schmerz verbarg, den sie in sich trug.
„Regen hält nicht ewig an, habibi. Er hilft der Erde, grün zu werden.“
Nada hielt eine kleine Puppe aus alten Stoffresten im Arm und blickte ihre Mutter mit großen, neugierigen Augen an.
„Mama, wird die Erde hier auch grün werden?“
Hanan zögerte einen Moment, als ob ihr die Worte im Hals stecken blieben. Sie konnte es nicht ertragen, die Hoffnung in der Stimme ihrer Tochter zu ersticken.
„Ja, mein Schatz. Eines Tages wird es so sein.“
Der Regen wurde stärker und Wasser sickerte durch das Zeltdach. Hanan nahm ein altes Stück Stoff und versuchte verzweifelt, die undichten Stellen abzudichten. Adnan, der Jüngste, schien die Kälte und Feuchtigkeit nicht zu bemerken. Er lachte, zeigte auf die Wassertropfen, die von der Decke fielen, und versuchte vorherzusagen, wo sie als Nächstes landen würden.
„Mama, der nächste Tropfen wird hier fallen!“, rief er und zeigte auf eine Ecke des Zeltes.
Wir lachten alle, sogar Hanan, obwohl ich die Erschöpfung in ihren Augen sehen konnte. Für einen kurzen Moment verwandelte ihr Lachen das kalte, feuchte Zelt in einen Ort der Wärme.
Später am Abend wandte Ibrahim seine Aufmerksamkeit dem unbeleuchteten Ofen in der Ecke des Zeltes zu.
„Mama, machst du heute Abend das Feuer an?“, fragte er hoffnungsvoll.
Hanan schüttelte sanft den Kopf und verbarg die bittere Tatsache, dass es keinen Brennstoff zum Verbrennen gab. „Vielleicht morgen, wenn der Regen schwächer ist“, sagte sie.
Plötzlich meldete sich Nada zu Wort. „Mama, ich möchte Brot, wie du es früher zu Hause gebacken hast!“
Hanan erstarrte für einen Moment, die Erinnerung an ihr altes Leben traf sie wie eine Welle. Damals erfüllte der Geruch von frischem Brot ihr Zuhause und die Kinder warteten sehnsüchtig auf ein warmes Stück direkt aus dem Ofen. Jetzt fühlt sich selbst eine Handvoll Mehl wie ein Luxus an.
Entschlossen, ihre Verzweiflung nicht an ihre Kinder weiterzugeben, durchsuchte Hanan ihre Habseligkeiten und fand eine kleine Menge Mehl, die sie aufbewahrt hatte. Sie mischte es mit Wasser und einer Prise Salz, formte kleine Teigscheiben und briet sie auf einem Stück Schrott über dem kaum funktionierenden Herd. Als sie den Kindern das Brot reichte, leuchteten ihre Gesichter auf, als hätten sie ein Festmahl bekommen.
Adnan biss in sein Stück und rief: „Mama, das schmeckt genauso wie das Brot, das wir mit Baba gegessen haben!“ Hanan lächelte, ihr Herz war schwer und zugleich erfüllt. Ihr Mann Fadi wurde in den ersten Kriegstagen von israelischen Streitkräften entführt, und seine Abwesenheit ist für Hanan und ihre Kinder seither ein schmerzlicher Verlust.
Als der Regen nachließ, saßen wir zusammen und Hanan begann, Geschichten über ihr altes Zuhause zu erzählen. Sie sprach von dem Olivenbaum, der ihrem Garten Schatten spenden würde, und von dem Feld, auf dem Fadi einst Weizen anbaute.
Ibrahim hörte aufmerksam zu und sagte plötzlich: „Wenn wir zurückgehen, werde ich einen neuen Olivenbaum pflanzen.“ Hanan legte ihre Hand auf seine und antwortete: „Wir werden ihn zusammen pflanzen, mein Schatz, und er wird der größte Baum in Al-Zawayda sein.“
Als die Kinder schließlich eingeschlafen waren, sah ich, wie Hanan still dasaß und an die Zeltdecke starrte. Der Regen hatte sich zu einem sanften Nieselregen verlangsamt, die Tropfen fielen rhythmisch durch die Löcher über uns. Trotz allem lag ein Hoffnungsschimmer in ihren Augen – nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Kinder. In ihrer stillen Stärke trug sie eine so tiefe Liebe in sich, dass sie selbst die dunkelste, kälteste Nacht erhellte.
In Gaza ist das Überleben ein täglicher Akt des Trotzes, und es grenzt an ein Wunder, in einem vom Regen durchnässten Zelt Momente des Lachens und der Wärme zu finden. Quelle |
|
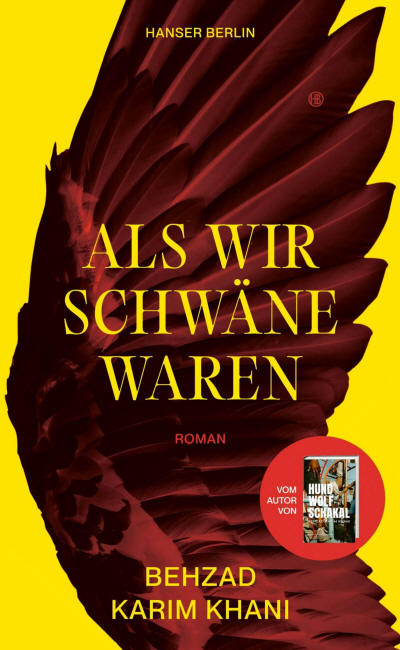 Wir befassen uns hier normalerweise nicht mit Literaturkritik, machen aber eine Ausnahme anlässlich des zweiten Buches von Wir befassen uns hier normalerweise nicht mit Literaturkritik, machen aber eine Ausnahme anlässlich des zweiten Buches von
Behzad Karim Khani, „Als wir Schwäne waren“.
Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost - 10. Januar
In seinem ersten Buch, „Hund, Wolf, Schakal“, kann man sich nicht nur in unsichtbare Nachbarn hineinversetzen, die oft für viele im Verborgenen in Berlin leben, sondern auch die Bedeutung des sozialen und kulturellen Aufwachsens am sozialen Rande der Stadt verstehen – und gleichzeitig mitten in ihrem Zentrum, nämlich in Neukölln.
Wie alle Türken und Araber in Deutschland sind heute auch alle Juden entweder Einwanderer oder Kinder von Einwanderern. Es gibt vielleicht fünf oder zehn jüdische Familien in Deutschland, die seit Generationen hier leben und weiterhin jüdisch sind. Alle anderen wurden ausgelöscht, und die Juden, die heute in Deutschland leben, stammen hauptsächlich aus Osteuropa. In den letzten Jahren kamen hinzu jüdische Einwanderer aus den USA, Kanada und vor allem aus Israel, darunter auch arabische Juden. Nicht zufällig leben die meisten Israelis in Neukölln und Prenzlauer Berg – vor allem unter anderen Einwanderern.
Wer deutsche Literatur liest, trifft nur selten auf Einwanderer wie sich selbst. Deshalb war es erfrischend, „Hund, Wolf, Schakal“ allein schon aus dieser Perspektive zu lesen. Nach diesem ausgezeichneten ersten Roman war es spannend, „Als wir Schwäne waren“ zu lesen – und sehr enttäuschend, zu hören, wie die Weiße literarische Kritikerszene in Deutschland darauf reagiert. Auch wenn das nicht wirklich überrascht. Wenn man zum Beispiel diesem Gespräch von Denis Scheck in vom SWR (Link im ersten Kommentar) über das Buch zuhört, versteht man, wie sehr die meisten der diskutierenden Kritiker:innen aus einer Weißen, elitären Perspektive sprechen, von der aus sie überzeugt sind, Kritik üben zu können, ohne sich die geringste intellektuelle Mühe zu machen.
Behzad Karim Khani erzählt die Geschichte einer ganzen Generation. Nachdem Deutschland sogenannte Gastarbeiter "importierte", vor allem aus der Türkei, aber auch aus Italien und Portugal, war die deutsche Gesellschaft überzeugt, dass das Wirtschaftswunder nach dem totalen Scheitern des nationalsozialistischen Wahnprogramm allein den weißen Deutschen und ihrer protestantischen Arbeitsethik zu verdanken sei. Alle anderen waren nur „Gäste“.
Das Buch beschäftigt sich mit dem deutschen Konzept der Gastfreundschaft und beginnt nicht zufällig mit einer Szene, in der die Kinder der weißen Deutschen den „Gästen“ in Deutschland das Gastgeben aufzwingen. Drei Kinder aus der Nachbarschaft, die die Einstellung ihrer Eltern zur Gastfreundschaft verinnerlicht haben, laden sich selbst zum Abendessen bei einer persischen Familie ein. Schon in dieser Szene steckt die gesamte Dramatik der Geschichte (im weiteren Verlauf erfahren wir, wie sie das verinnerlicht haben und wer ihre Eltern sind). Sie sind einerseits neugierig, was die „Perser“ essen, andererseits aber nicht wirklich neugierig: Sie brauchen Ketchup, um das Essen „einzudeutschen“, damit es ihnen vertrauter wird. Sie müssen das Essen der "Gäste" - von denen sie Integration verlangen - in ihrer Welt integrieren. Die Eltern des Protagonisten ertragen diese Zerstörung, der Sohn jedoch weniger. Und die Erniedrigung liegt nicht im Ketchup selbst (der in der literarischen Diskussion als „Unkultur“ bezeichnet wird), sondern in dem, was er symbolisiert: die Instrumentalisierung anderer Menschen, als wären sie keine Menschen mit einem Zuhause, Privatsphäre, einem ganzen Leben und einer eigenen Kultur.
All das ist auch möglich, weil die deutsche Kultur eine Kultur der Knausrigkeit ist. Es gibt ganze Facebook-Seiten von Gruppen aus Italienern, Israelis oder anderen Einwanderern, die in Deutschland leben und fassungslos über die wenig großzügigen deutschen Sitten sind. Wer aus einer Kultur des Überflusses kommt, in der ein Gast jemand ist, den man verwöhnt (manchmal bis zur Erstickung), wundert sich über die deutsche Kultur. Denis Scheck versteht nicht, warum der Schriftsteller sich auf den Werbeslogan „Geiz ist geil“ bezieht, als ob das etwas aussagen würde. Wie könnte er nicht? Schließlich sitzen Heerscharen von Werbern, Psychologen und „creatives“ zusammen und überlegen, wie sie etwas an eine bestimmte Zielgruppe verkaufen können. Und nur in einem Land wie Deutschland kann man auf diesen Satz kommen, in dem Geiz und Knausrigkeit als cool und attraktiv dargestellt werden. Wir könnten ein Lied von dem ersten Essen singen, zu dem wir in das Haus eines Weißen deutschen eingeladen wurden (und es dauert, bis ein Deutscher dich in sein Haus lässt), und dann gab es einfach Spaghetti Bolognese – und das war’s.
Das Buch beschreibt ein soziales Phänomen: Nachdem 2015 eine Million syrischer Geflüchtete mit offenen Armen aufgenommen wurden, kam der Rückschlag: „Wenn sie hier nicht arbeiten, sollen sie zurückgehen.“ Und schon einen Tag nach dem Sturz von Assad gibt es Gespräche darüber, wie man dafür sorgt, dass dies geschieht. Geiz ist geil.
Denis Scheck und Nele Pollatschek verstehen die Wut des Protagonisten des Buches nicht. „Er war doch auf dem Gymnasium!“ sagen sie. Das heißt, er hat es in den Tempel der deutschen Elite geschafft und nicht die gleiche Behandlung erfahren wie andere Ausländer, die die Schulen der Weißen Unterschicht bevölkern. Anscheinend haben sie das Buch gelesen und gesehen, dass außer ihm nur ein weiteres türkisches Kind auf dem Gymnasium war. So ist das in Deutschland: Wenn du ein weißer Deutscher aus einer durchschnittlichen Familie bist, kommst du dorthin und hast danach gute Chancen, beim Radio zu arbeiten und über „die Anderen“ zu sprechen. Aber um als Migrant oder Kind von Migranten aufs Gymnasium zu kommen, musst du überdurchschnittlich gut sein.
Es fällt diesen Literaturkritiker:innen schwer, sich vorzustellen, dass sich der Protagonist des Buches mit den anderen identifiziert, die es nicht in diesen Tempel geschafft haben. Dass sie nicht-weiße Migranten sind und keine Eltern haben, die zur Schulleitung gehen und ihre Kinder während des Selektionsprozesses am Ende der vierten oder sechsten Klasse verteidigen können. Es ist schwer für sie zu verstehen, dass das Erlebnis des Andersseins dazu führt, dass sich Migrant:innen in Deutschland heute mit den Juden als Opfer der Deutschen während des Holocausts identifizieren.
Diese beiden Kritiker (den Ruf der Sendung retten ein bisschen Shelly Kupferberg und Ijoma Mangold) glauben, der Protagonist des Buches „leiht“ sich seine Wut von den Juden. Und dann wagt er es auch noch, die Schoah anzusprechen. Wenn er nicht nur über die NS-Vergangenheit Deutschlands spricht, sondern auch über seine Gegenwart, etwa in Form eines Tattoos des Eingangstors von Auschwitz, erscheint das ihnen bereits „unglaubwürdig“. (Darüber können wir auch ein Lied singen: zu glauben, dass Abiturient:innen in Deutschland etwas über die NS-Vergangenheit wirklich wissen, ist realitätsfern).
Für Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft ist es völlig normal, dass „die Anderen“ (all diese Ausländer mit ihrer Folklore und dem guten Essen) das Objekt ihrer Analyse sind. Es fällt ihnen schwer, ihre Perspektive zu ändern und selbst wie diese Deutschen zu sein: das heißt, jemand, der einer ethnischen Gruppe mit einer bestimmten Kultur angehört, geizig, mit einer Vergangenheit und Gegenwart der Vernichtung, und nicht gerade großzügig. Wann hat Ihr Kind das letzte Mal ein Lob von seiner Lehrerin bekommen? Wie großzügig sind Lehrer des deutschen Schulsystem damit?
Viele Europäer sind es gewohnt, die „jüdische Seele“ zu analysieren und zu pathologisieren, wie man uns erzählt, wir seien Juden mit „Selbsthass“. Das hat eine lange Tradition, in der deutsche Psychiater, Ärzte und Psychologen unsere Seele gemessen und analysiert haben. Wenn sich das plötzlich umkehrt, erscheint es ihnen „unglaubwürdig“. Oder sie degradieren das Buch sofort, indem sie es in eine minderwertige Kategorie einordnen und sagen, es sei ein „Mafia-Roman“ ( "Als wir Sxhwäne waren" ist ein Mafia-Roman, wie Thomas Manns Zauberberg ein Kurortroman ist) oder nennen es eine „Milieu-Studie“ (ist Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas auch eine „Milieu-Studie“, oder haben nur „die Anderen“ aus weißer Sicht ein „Milieu“?).
Nun, hier sind ein paar Fakten:
Wie der Protagonist des Buches glaubten nicht wenige Migrant:innen nach Deutschland an die Versprechungen von „Integration“, erhielten Deutschlandstipendien und studierten sogar eines der wohl deutschesten Fächer, die Rechtswissenschaften. Doch in den letzten Jahren hat sich das Blatt gewendet: Die meisten verstehen, dass dieses Versprechen nur eine vorübergehende Modeerscheinung war. Jetzt ist Deutschland demonstrativ geizig und grausam geworden, es ist „geil“, zu singen: „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus.“
Nicht wenige Deutsche planen ihre Auswanderung aus Deutschland, viele davon Migrant:innen oder Kinder solcher. Sie alle empfinden in unterschiedlichem Maße Enttäuschung und Wut, einige fantasieren sogar von Deutschlands Verschwinden. So ist das, wenn man Menschen einlädt, „Gäste“ zu sein, und sie dann schlecht behandelt. Das weckt keine Gefühle von Zuneigung und Liebe. Für den Protagonisten dieser Geschichte ist das besonders verständlich. Wenn man verstehen will, sollte man die Tore des Herzens nicht geizig verschließen, denn das ist gar nicht geil. Quelle |
|

Um das Video zu sehen, auf das Bild klicken
|
|

Ein Restaurant eröffnen in der dunkelsten aller Zeiten
Nour Abu Dan - 11. Januar 2025 - Übersetzt mit DeepL
Letzten Dezember sah ich eine Anzeige für ein neues Café in Gaza-Stadt, im Viertel al-Sahaba, das sich Relax Café nannte.
Zuerst dachte ich, es sei eine alte Anzeige, die an das Leben vor dem Krieg erinnert. Aber zu meiner Überraschung war es ein aktueller Beitrag, und das Café war erst im November eröffnet worden. Ich konnte nicht glauben, dass jemand ein neues Restaurant eröffnet hatte, besonders im Norden von Gaza.
Sofort kam mir der Gedanke, dass ich meine Kinder Yumna (5) und Abdul Karim (3) in dieses Café mitnehmen könnte, um ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, wie das Leben vor dem Krieg war. Sie sind noch zu jung, um sich an viel mehr als unsere jetzige Realität zu erinnern, und ich fürchte, dass sie dabei sind, alles über unser früheres Leben zu vergessen.
Also gingen wir am nächsten Tag hin. Die meisten Tische waren besetzt, und das zu Recht. Jeder braucht einen Ort, an dem er sich ausruhen kann, einen Ort, an dem er dem Schatten des Krieges entfliehen kann, und sei es nur für ein paar Augenblicke. Zum Glück fanden wir einen freien Tisch in einer ruhigen Ecke.
Wir setzten uns und ich ließ meinen Blick ungläubig durch den Raum schweifen. Die Einrichtung war schlicht, aber wir fühlten uns wie im alten Gaza.
Yumna und Abdul Karim sahen sich mit großen Augen um: In unserer zerstörten Welt etwas Neues zu sehen, war für sie überwältigend.
Der Kellner kam, reichte uns die Speisekarte und ich war neugierig, was wohl darauf stehen würde. Wie konnte es in Gaza etwas zu essen geben, wo es fast nichts mehr gab?
Aber dann erinnerte ich mich daran, dass die Menschen in Gaza genau wissen, wie man das Beste aus dem macht, was man hat.
Die Gerichte waren einfach und einfallsreich, mit den Zutaten, die uns noch zur Verfügung standen: Thunfisch- und Fleischkonserven und ein paar einfache Backwaren. Alles Grundnahrungsmittel, die heute Luxusgüter sind.
Die Preise waren natürlich höher als vor dem Krieg, aber im Großen und Ganzen waren sie im täglichen Leben hier moderat.
Als das Essen kam, fühlte ich mich komisch. Obwohl ich diese Gerichte schon oft zu Hause für meine Kinder gekocht hatte, kochten wir in letzter Zeit nur noch auf offenem Feuer, und dieses Feuer hinterlässt immer schwarze Streifen auf allem, was wir essen.
Das Fehlen dieser Brandflecken war eine willkommene Abwechslung.
Die Teller waren weiß und sauber. Die Präsentation war wunderschön. Es war ein großer Unterschied zu dem Ruß und dem Rauch, die jede Mahlzeit zu Hause begleiten.
„Wir verdienen Momente der Freude, auch wenn sie noch so klein sind“.
Während wir aßen, kam der Kellner auf Yumna zu und tätschelte ihren Kopf. Er fragte sie nach ihrem Namen und als sie antwortete, bemerkte ich eine Veränderung in seiner Stimme.
Er sagte, dass dies der Name seiner Schwester sei und dass sie als Märtyrerin gestorben sei.
Seine Worte trafen mich wie ein Schlag und erinnerten mich - obwohl ich es nie wirklich vergessen hatte - an die Tiefe des Verlustes, mit dem wir jeden Tag leben, auch wenn wir versuchen, Routine und kleine Freuden zu finden.
Als ich mich in dem kleinen Restaurant umsah, wusste ich, dass jeder Tisch seine eigene Geschichte und unermessliche Trauer hatte. Auch wenn sich dieser Ort wie eine Oase im Schmerz des Alltags anfühlte, trugen wir unsere Verluste mit uns herum.
Ich sprach mit Ibrahim, dem Besitzer, und fragte ihn nach dem Restaurant: Was hatte ihn dazu bewogen, es mitten im Krieg zu eröffnen, wo doch alles in Gaza ein Ziel war?
Er war jung, voller Energie und Enthusiasmus.
„Es war ein Projekt, das mein Bruder und ich drei Jahre lang geplant hatten“, sagt er. “Wir waren bereit, es zu eröffnen, als der Krieg ausbrach, aber alles verzögerte sich und unsere Pläne wurden zunichte gemacht.“
Er sagte, er habe es Monat für Monat aufgeschoben, in der Hoffnung, dass der Krieg zu Ende gehen würde.
„Aber nach einer Weile wurde mir klar, dass die Menschen jetzt einen Ort wie diesen brauchen. Wenn der Krieg jede Spur des Lebens, das wir kannten, zerstört, müssen wir handeln und können nicht auf sein Ende warten.“
Er hat immer noch Angst vor den Risiken, die mit der Eröffnung eines solchen Ortes verbunden sind, davor, alles zu verlieren und ganz von vorne anfangen zu müssen.
„Die Gefahr lauert überall, wo wir hingehen“, sagt er. “Aber das sollte uns nicht vom Leben abhalten. Wenn wir warten, bis der Krieg vorbei ist, bekommen wir vielleicht nie wieder die Chance zu leben. In diesem Café geht es nicht nur ums Essen, sondern auch darum, die Menschen daran zu erinnern, dass das Leben weitergeht, selbst in den dunkelsten Zeiten.
Dieses Café war genau das, was ich brauchte. Es erinnerte mich daran, dass das Leben weitergeht, egal wie schwer es ist.
„Wir haben so viel verloren“, sagt er. “Dieses Café ist unsere Art zu sagen, dass wir noch da sind, dass wir noch leben und dass wir Momente der Freude verdienen, auch wenn sie noch so klein sind.“ Quelle |
Archiv
Ältere Seiten ab dem 18.4.2009 finden Sie im Web Archiv >>>
|